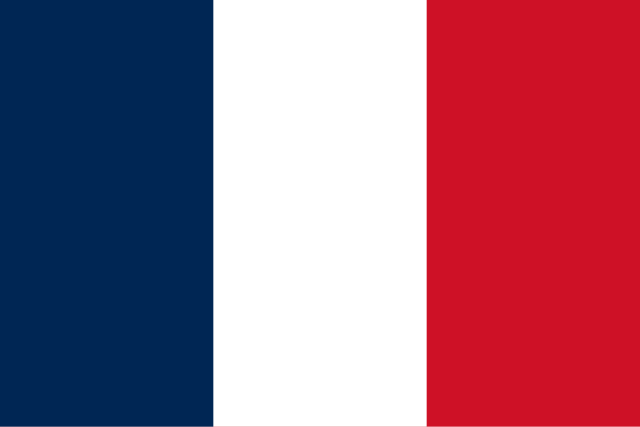Schon wieder eine Stunde der Wahrheit?Das Freihandelsabkommen zwischen EU und MERCOSUR ist unterzeichnet – und gleichzeitig noch weit davon entfernt Realität zu werden.
- 9. Dezember 2024
- Veröffentlicht durch: ema-wpadmin
- Kategorien:

Am Tag der Unterzeichnung: Die Sonne scheint über dem Sitz des MERCOSUR in Uruguays Hauptstadt Montevideo (Foto: Thomas Schiller)
9. Dezember 2024
von Thomas Schiller und Dr. Georg Dufner
Das Freihandelsabkommen zwischen EU und MERCOSUR ist unterzeichnet – und gleichzeitig noch weit davon entfernt Realität zu werden. Noch viele Hürden müssen genommen werden. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten haben sich offen gegen das Abkommen gestellt oder sind zumindest kritisch: Frankreich vor allem, aber auch Polen, Italien oder auch Österreich haben sich entsprechend positioniert. Es handelt sich also lediglich um einen ersten Schritt. Dennoch: nach Jahren der Verhandlungen geht es vorwärts.
Die neue Geopolitische Realität
In Zeiten neuer geopolitischer Realitäten ist dieses Abkommen kaum überzubewerten. Endlich einmal folgt der Rhetorik der „Diversifizierung“ der ökonomischen Beziehungen Europas eine Tat. An dieser Stelle sollte im Übrigen die Geschichte bemüht werden: Argentinien oder Uruguay stiegen Ende des 19.Jahrhunderts zu wohlhabenden Staaten auf, weil europäisches Kapital und europäisches Knowhow die Dynamik dieser jungen Länder auf der Südhalbkugel gefördert hatte: Die Eisenbahnen in Südamerika entstanden mit britischem Kapital und es sind bis heute englische Rinderrassen (Angus oder Hereford beispielsweise), die auf den riesigen Weiden grasen. Aber auch das kritische Frankreich und Deutschland waren damals enger mit den südamerikanischen Ländern vernetzt als heute. Die künftigen ökonomischen Verbindungen zwischen EU und Mercosur sollten sich auf diese historischen Realitäten besinnen.
Gleichwohl: Bauernproteste in Frankreich, Deutschland, Belgien und Polen sprechen eine andere Sprache. Und die EU sollte diese Proteste ebenso ernst nehmen wie die dazu passenden, ablehnenden Haltungen vieler nationaler Regierungen.
In der Zeitenwende sind europäische Versorgungssicherheit und Resilienz – auch im Agrarbereich – ganz anders zu bemessen als in den Jahren der glücklichen Illusionen. Und Besorgnisse der bürokratiegeplagten Landwirte sind ernst zu nehmen.
Der mißverstandene Freihandel
Aber: Freihandel ist gerade kein Projekt der „Multis“, wie orchestriert gleichermaßen gewisse Medien und bestimmte Politiker der Öffentlichkeit weismachen wollen. Weltkonzernen kann Freihandel letztlich egal sein. Sie sind ohnehin überall präsent und produzieren weltweit. Stattdessen ist Freihandel gerade für mittelständische europäische Industrie essentiell, die größtenteils Hochtechnologie exportiert. Für Deutschland gilt das umso mehr.
Der gerne von Globalisierungsgegnern aufgebaute Gegensatz – Weltkonzerne gegen Freunde der heimischen Scholle – ist himmelschreiend falsch. Wahr ist, dass gerade die regional verwurzelten mittelständisch geprägten Unternehmen und damit die Fläche Europas vom Freihandel profitiert. (Das gilt in Ostwestfalen und in Oberösterreich, im Trentino und im Ländle, in Bayern und in Katalonien.) Und es gilt mehr denn je: Diversifizierung tut angesichts der Gefährdung von Absatzmärkten in China und USA not. Sie ist ein wirtschaftspolitischer Imperativ.
Freier Handel unter Freunden
Und freier Handel unter Freunden – wie es die Mercosur-Staaten sind – ist heute geopolitisches Gold, das man nicht auf der Straße herumliegen lassen sollte – sonst nehmen es andere mit. Und ganz grundsätzlich: Will Europa wirklich ständig mit dem erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen? Man redet von „Wertepartnerschaft“ und schlägt dann eine Partnerschaft mit den Demokratien Südamerikas aus? Wollen wir das wirklich? Es gilt jetzt die Chancen zu nutzen.
Was also tun, angesichts des Furors der Landwirte, der Gegnerschaft in Wien, Paris oder Warschau?
Einziger Weg aus dieser Misere ist die ehrliche Verhandlung. Die Bedenken der europäischen Landwirtschaft sind real. In Zeiten wie diesen wird Brüssel diese auch nicht mehr mit Geld und hochbürokratischen „Förderprogrammen“ oder Subventionen zuschütten können. Wenn interventionistische Wirtschaftspolitik ausscheidet und wohlmeinende Bevormundung in Südamerika abgelehnt wird bleibt nur: Pragmatik. Stufenweise Inkraftsetzung, Kontingente und Zölle für empfindliche Produkte wie Rindfleisch und Zucker. Hand in Hand damit einhergehen muss die sukzessive Harmonisierung von Standards im Lebensmittelbereich, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Und zugleich: man kehre zuerst vor der eigenen Tür: Abbau von Bürokratie und Vorschriften hilft den europäischen Landwirten mehr, als erneut kostspielige (und komplexe) Förderprogramme aufzulegen, die man sich künftig kaum mehr wird leisten können.
Eine einmalige Chance
Das Abkommen ist eine Chance, endlich auch in Europa notwendige Schritte zu unternehmen. Das Schüren von Ängsten und Bedenken kann gekontert werden, wenn Europa und Südamerika beide die Partnerschaft wollen und beide die dafür notwendigen Schritte unternehmen. Nur so kann die Annahme gelingen und die EU ihren hochtrabenden Ansprüchen an wirksame Politik in der Ära der Zeitenwende gerecht werden. Wollen wir hoffen, dass es die letzte – und diesmal glückliche – Stunde der Wahrheit für das EU-Mercosur Abkommen sein wird.